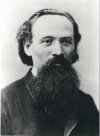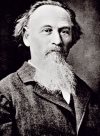unsere historie
Ein Schnelldurchlauf durch die Geschichte der Industriearchitektur – das ist es, was die schönherr.fabrik bietet
Denn der Standort wird seit über 200 Jahren industriell genutzt, zunächst als Mühle, später als Spinnerei, schließlich als Heimat des Maschinenbaus und heute als multifunktionales Gewerbegebiet – regelmäßige Neu- und Umbauten inklusive. Es war Louis Ferdinand Schönherr, der das Gelände unweit des Chemnitz-Flusses zur ersten Blüte führte: Er startete ab 1851 die industrielle Serienproduktion von Webstühlen zur Herstellung von Tuchen und Möbelbezugsstoffen, 1871 produzierte er den 10.000sten Webstuhl.Eigene Gießerei und Betriebsfeuerwehr, eine auf Spul- und gar Baumaschinen ausgeweitete Produktion – bis 1914 stieg Schönherrs Mitarbeiterzahl auf über 1.600 Beschäftigte. Entsprechend groß ist das Areal, das heute – nach zwischenzeitlicher Enteignung und Nutzung durch das Kombinat Textima – zur Verfügung steht: ca. 83.000 Quadratmeter. Webmaschinen werden heute keine mehr produziert. Dafür entstand aber – nach schrittweiser Sanierung – ein breites Spektrum neuer Mieter: Gewerbe und Dienstleistungen, Kunst und Kultur, Gastronomie und Handel, Schulungseinrichtungen und Sportangebote, insgesamt 100 Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern sind inzwischen in der schönherr.fabrik angesiedelt.
Eine zweite Blütezeit und eines der erfolgreichsten Revitalisierungsprojekte von Industriegebäuden in Chemnitz.
Einen kurzen geschichtlichen Abriss finden Sie nun hier: Weitere Details können Sie gern in unserer Chronik nachlesen.
1872
Im Herbst bestreiken über 8.000 Metallarbeiter die Chemnitzer Fabriken mit der Forderung nach einem Zehn-Stunden-Arbeitstag. Streikbrecher kommen hauptsächlich aus der Schönherrfabrik. Hier besteht die Mehrzahl der Mitglieder der Belegschaft aus der Landbevölkerung. Diese ist auf Grund der schlechten Lebensbedingungen auf jeden Lohn angewiesen. Der Streik endet zugunsten der Unternehmer. Die Beschäftigtenzahl geht bis Ende der 1870er Jahre von 700 auf 450 Beschäftigte zurück.Daten im Überblick
Areal: 105.000 m², davon ca. 25.000 m² bebautAuslieferung: 10.000 Webstühle
5.023 Spulmschinen
2.917 Scheer- und Baumaschinen
399 Leinen- und Schlichtmaschinen
Arbeiterentlohnung: 5 1/6 Taler Wochenlohn Maschinenschlosser
4 2/3 Taler Wochenlohn Maschinentischler
Insgesamt werden 81.423 Maschinen im Wert von ca. 100 Millionen Mark mit 127.740 Mark Reingewinn ausgeliefert.
1932
Die erste 2-schützig arbeitende Doppelteppichwebmaschine, Modell PSD1 wird ausgeliefert. Damit ist die entscheidende technische Lösung zur industriellen Großproduktion von gewebten Teppichen gelungen.Die Sächs. Webstuhlfabrik AG entwickelt sich zum zweitgrößten Chemnitzer Unternehmen nach der Textilmaschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann AG.
1944/1945
Von 1925 bis 1944 werden 2.269 Teppichwebmaschinen der Modelle O, OD, PS1 und PSD gebaut, davon werden 996 Maschinen exportiert.5. März 1945: In der Sächsischen Webstuhlfabrik werden durch den Luftangriff auf Chemnitz ein Teil der Tischlerei, die Putzerei, ein großer Holzschuppen und ein Gusslager zerstört bzw. schwer beschädigt.
1946
Die Treuhand der Stadt Chemnitz verwaltet die Sächsische Webstuhlfabrik. Dort beginnt der Wiederaufbau mit zunächst 70 Beschäftigten. Aus alten Brettern werden Fenster und Türen gezimmert, damit Arbeits- und Büroräume provisorisch wieder hergestellt und mit primitiver Beleuchtung und Heizung versehen werden können.Werkzeugmaschinen werden aus dem Schutt anderer zerstörter Chemnitzer Betriebe geborgen und instandgesetzt. Sie bilden die Grundlage für die Errichtung einer mechanischen Werkstatt in der Sächsischen Webstuhlfabrik.
1950
Im Betrieb werden erstmalig nach dem zweiten Weltkrieg wieder komplette Webmaschinen gefertigt.Erneute Produktionsaufnahme von Doppelteppichwebmaschinen nach dem Krieg. Der VEB Webstuhlbau entwickelte sich wieder zum zweitgrößten Chemnitzer Unternehmen nach der Textilmaschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann AG.
1994
Die Ventana-Gruppe (Gesellschafter Dr. Hannes Winkler, Dr. Ernst Lemberger) aus Wien übernimmt das gesamte Unternehmen „Chemnitzer Webstuhlbau“, ändert den Firmenname in "Schönherr Chemnitzer Webmschienenbau GmbH" und treibt dessen Strukturierung und Sanierung voran.Die produzierenden Bereiche mit der Gießerei, Webstuhlmontage und Teilefertigung werden in das jetztige Areal „Schönherr-Industriepark“ verlagert. Alle unter Denkmalschutz stehenden Gebäude im vorderen Teil werden leergezogen. Insgesamt 30.000 m² Geschoßfläche stehen damit im Teil „Schönherr-Fabrik“ zur Umnutzung zur Verfügung.
1999
Durch eine in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie wird belegt: Handels- und Gewerbeflächen sind schon überzählig in der Stadt vorhanden, aber Bedarf für die Nutzungen Kultur, Freizeit und Sport besteht noch. Seitdem wird unter dem Arbeitstitel „Schönherr Kulturfabrik“ ein sehr praktisches Konzept durch eine etappenweise Umsetzung in Bauabschnitte realisiert.2000
1. Bauabschnitt: Eröffnung des ersten Teils der „Schönherr Kulturfabrik“ mit neu geschaffenem Raum und neuen Nutzern. Übergabe der ersten Flächen in den Gebäuden 3, 8a und 5a (insgesamt 2.500 m² renovierte Fläche) an die ersten Mieter.Verkauf des Tochterunternehmens Schönherr Metallverarbeitung GmbH, mit 90 Mitarbeitern, an die Trompetter Verwaltungs GmbH.
2014
8. Bauabschnitt: Im Gebäude 7a, 7b und 8c entstehen auf 3 Etagen Mietflächen mit insgesamt 3.400 m². Erstmals wurde die Dachgeschossfläche ausgebaut. Die Außenmauern des Gbeäudes 39 wurden abgerissen. Auf dieser Fläche wurde ein neuer Parkplatz angelegt.Es wird die SCHÖNHERR GASTRO Gmbh gegründet. Das neue Restraurant "max louis" wird Mitte 2015 eröffnet und selbst betrieben.
2016/2017
Im 9. Bauabschnitt wurden ca. 700 m² Mietfläche im Gebäude 7c saniert. Jede Etage (EG, 1.OG und DG) hat ca. eine Grundfläche von ca. 230 m². Im Dachgeschoss wurden wie im Gebäude 7b großzügige Gauben eingebaut, damit das Dachgeschoss den Anforderungen einer natürlichen Belichtung für eine Büronutzung gerecht wird.Das Gebäude 6 und der Übergang zum Gebäude 40 wurde abgerissen.
Dieser Bauabschnitt wurde im Rahmen des 200-jährigen Geburtstags von Louis Schönherr im Jahr 2017 fertiggestellt.
2017
200 Jahre Louis F. Schönherr:Am 22. Februar 2017 jährte sich der Geburtstag von Louis F. Schönherr zum zweihundertsten Mal. Er gilt zusammen mit seinem Bruder Wilhelm als Erfinder des mechanischen Tuchwebstuhls und machte damit Sachsen im 19. Jahrhundert für die Tuch- und Wollwarenbranche unabhängig von englischen Importen. Zahlreiche Veranstaltungen führen durch das Jahr. Nicht nur in der schönherr.fabrik selbst, sondern auch an anderen Standorten wird das Wirken und Schaffen von Louis F. Schönherr geehrt. Dazu gehören zum Beispiel die Schauweberei Braunsdorf, die Camman-Manufaktur und das Industriemuseum.
2019
Das K40, liebevoll als Kreativhaus bekannt, stellt mit einer Gesamtfläche von ca. 5.700 m², inklusive Keller, und etwa 4.100 m² Mietfläche den bisher größten Bauabschnitt (10. Bauabschnitt) auf dem Gelände der schönherr.fabrik dar.Im Herbst 2019 begannen die umfangreichen Baumaßnahmen. Der Stahlbetonbau diente ursprünglich während der DDR-Zeiten als Lager für die Endfertigung und die Lehrausbildung. Vor 10 Jahren fand es eine neue Bestimmung als Heimat für zahlreiche Künstler.
Die Sanierung präsentiert sich mit einer kreativen und bunten Handschrift. Der industrielle Charakter wurde im Inneren bewahrt, mit rohen Decken, offenen Kabeln und Leitungen sowie den erhaltenen gusseisernen Fenstern. Das Mauerwerk wurde sandgestrahlt und bleibt sichtbar.
2022

Gebäude 1 - Außenansicht
Im Oktober 2022 wurde der Kaufvertrag nach kurzer und zielführender Verhandlung für das Gebäude 1 beurkundet. Dies war in jeder Hinsicht ein bedeutsamer Schritt, denn das über 11.000 m² große Grundstück bietet fantastisches Potenzial für die Weiterentwicklung und Umgestaltung des Standortes. Sobald die Restauration des K40 erfolgreich abgeschlossen ist, soll sich mit lauter Tatendrang und kreativen Ideen auf das ehemalige Verwaltungsgebäude und die dazugehörige Freifläche fokussiert werden. Das seit 2008 in der ehemaligen Ausstellungshalle im Gebäude 2 befindliche „Alternative Jugendzentrum e.V.“ bleibt natürlich mit der Inline-, Skate- und BMX-Halle Druckbude bis auf weiteres am Standort. Die restliche Fläche wird derzeit als Parkplatz genutzt.
2. Juni 2023

Gienanth Chemnitz
Unermüdlich kämpften die Einsatzkräfte der Chemnitzer Feuerwehr gegen die aus der Gießerei lodernden Flammen. Ohne Sie und weitere fleißige Helfer und Helferinnen wäre unsere Schönherrfabrik möglicherweise in großer Gefahr gewesen. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Demententsprechend können wir im Namen der gesamten Schönherrfabrik gar nicht genügend unseren Dank bekunden.